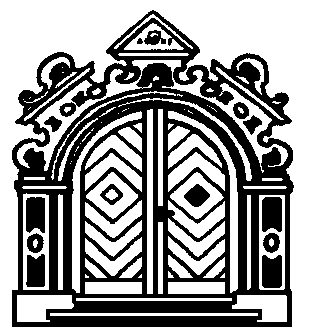
Geschichtsverein
Bietigheim-Bissingen
Bericht über die Projektvorstellung beim Geschichtsverein Bietigheim-Bissingen am 8.5.2025

Barackenlager in der Grünwiesenstraße
(Foto: Stadtarchiv Bietigheim-Bissingen)

Die Referenten: Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse des Technischen Gymnasiums im Beruflichen
Schulzentrum im Fischerpfad
(Foto: Wilhelm Fahrbach)
Die monatliche Geschichtsvereinsrunde im Enzpavillon war im Mai eine besondere Veranstaltung: Statt des üblichen Vortrags präsentierten die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse des Technischen Gymnasiums im Beruflichen Schulzentrum im Fischerpfad die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zur Lage der Heimatvertriebenen in Bietigheim unmittelbar nach dem Kriegsende. Ausgangspunkt für die Nachforschungen der Klasse war der Film „Der Kreis Ludwigsburg baut auf“. Unter der Leitung ihrer Geschichtslehrerin Lena Ambrus untersuchten die Schülerinnen und Schüler, ob die Darstellung der Situation der Vertriebenen in dem Film der Realität entsprach. Sie befragten dazu zwei Zeitzeugen und sammelten Informationen in verschiedenen Veröffentlichungen des Stadtarchivs.
So fern die Jahre nach Kriegsende für heutige Jugendliche auch sein mögen - der Blick auf die Vertreibung aus der Heimat ist gerade in der gegenwärtigen Migrationsdebatte sehr aktuell. Auch in dieser 10. Klasse gibt es einige, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden oder deren Eltern vor unmenschlichen Zuständen fliehen mussten. Darüber berichtete eine Schülerin in bewegenden Worten.
Der Film zeigt Bilder aus dem Barackenlager in der Grünwiesenstraße; er zeigt, wie in großen Wannen im freien Wäsche gewaschen wurde, wie an primitiven Kochstellen zwischen ein paar Ziegelsteinen gekocht wurde, wie Gemüse angebaut wurde, aber er zeigt auch, wie sich die Leute zum Spiel eines Akkordeons fröhlich vor der Baracke versammelten. Wer das Glück hatte, eine Wohnung zugeteilt zu bekommen, lud seine Habseligkeiten in ein paar Säcken auf einen Lastwagen und musste hoffen, dass er am neuen Wohnort so freundlich begrüßt wurde wie von der Frau aus Kleinsachsenheim, die im Film gezeigt wurde. Aber natürlich weigerten sich auch manche Wohnungsbesitzer, Vertriebene aufzunehmen, und der Bürgermeister Willi Krieg musste Räume beschlagnahmen und Zwangseinweisungen vornehmen. Sowohl für die Familien der Einheimischen als auch für die der Flüchtlinge war die Lage schwierig: Viele Personen drängten sich in wenigen Zimmern. Die Darstellung der Situation der Vertriebenen in dem Film ist nicht falsch, so fanden die Jugendlichen, aber sie ist unvollständig: Nur das Positive wird gezeigt.
Trotz der schwierigen Versorgungslage, trotz der großen Wohnungsnot gab es in Bietigheim auch positive Faktoren, die eine allmähliche Integration der „Fremden“ erleichterten: Es gab genug Arbeit, sei es beim Wiederaufbau des zerstörten Viadukts oder in den Betrieben, und die einheimische Bevölkerung zeigte ihren guten Willen durch eine hohe Bereitschaft zu Spenden.
Den Schülerinnen und Schülern, die die Ergebnisse ihrer Arbeit sehr gekonnt jeweils zu zweit vorstellten, war anzumerken, wie sehr sie die Beschäftigung mit den so anderen Lebensumständen der ersten Nachkriegsjahre beeindruckt hatte. Das zahlreich erschienene Publikum dankte ihrem Engagement mit großem Beifall.